Vergleich des E-ID-Gesetzes
von 2020 und der neuen Vorlage von 2024:
Was hat sich geändert und wurde der Volksentscheid berücksichtigt? Ist jetzt irgendetwas besser?
Vorgeschichte und Ausgangslage: Das E-ID-Gesetz von 2020 wurde in der Volksabstimmung vom 7. März 2021 mit deutlicher Mehrheit von 65 % abgelehnt. Hauptkritikpunkte der Stimmbürger waren:
- Privatisierung: Die E-ID sollte von privaten Identitätsanbietern (IdP) herausgegeben werden, während der Staat lediglich Datenlieferant blieb.
- Datenschutzbedenken: Die Befürchtung, dass private Anbieter nicht ausreichend Datenschutz gewährleisten können.
- Vertrauensmangel: Viele sahen eine Überwachung durch Dritte oder Datenlecks als Risiko.
Mit diesen Erkenntnissen ging der Bundesrat in einen neuen Anlauf und präsentierte 2024 eine revidierte Vorlage, die nun ein staatliches System vorsieht. Am letzten Tag der Wintersession 2024 haben Stände- und Nationalrat in ihren Schlussabstimmungen das Bundesgesetz über die elektronische Identität und andere elektronische Nachweise verabschiedet . Da es sich bei diesem Tag um den 20. Dezember 2024 gehandelt, ist das vermutlich von vielen Schweizern im Weihnachtstrubel gar nicht zur Kenntnis genommen worden. Wer wissen möchte, wer wie abgestimmt hat (was immer aufschlussreich ist), klicke auf diesen LINK.
Doch hat diese Überarbeitung die Bedenken der Stimmbürger wirklich beseitigt, oder handelt es sich eher um einen faulen Kompromiss? WIR vergleichen die beiden Gesetzestexte.
Kernunterschiede zwischen 2020 und 2024
1. Verantwortlichkeit für die Ausstellung der E-ID
- 2020: Das Konzept des Gesetzes von 2020 sah vor, dass private Anbieter, sogenannte Identitätsprovider (IdP), die E-ID herausgeben sollten. Der Staat wäre hierbei lediglich als Datenlieferant aufgetreten, der die Identitätsdaten zur Verfügung stellt, jedoch keine Kontrolle über die Herausgabe oder Nutzung der E-ID hätte. Diese Struktur wurde kritisiert, da die Verantwortung und Kontrolle für ein so sensibles Instrument in privater Hand lag, was Befürchtungen über Missbrauch und mangelnde Sicherheitsstandards hervorrief.
- 2024: In der neuen Vorlage übernimmt der Staat die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der E-ID. Der Bund stellt sowohl die Infrastruktur als auch die operativen Prozesse bereit und bleibt somit zentraler Akteur. Dies soll sicherstellen, dass das Vertrauen der Bürger durch direkte staatliche Kontrolle gestärkt wird und die Risiken einer Privatisierung minimiert werden.
Erweiterte Bewertung: Diese Änderung adressiert einen der zentralen Kritikpunkte und verlagert die Verantwortung in staatliche Hände. Während dies prinzipiell als Verbesserung zu werten ist, bleibt dennoch die Frage offen, ob der Staat ausreichend Mittel und technologische Expertise besitzt, um eine solch komplexe Infrastruktur sicher und effizient zu betreiben. Eine staatliche Kontrolle allein garantiert nicht automatisch eine lückenlose Sicherheit oder Effizienz.
2. Datenschutz und Datenspeicherung
- 2020: Das damalige Gesetz enthielt keine umfassenden Bestimmungen, die explizit Datenschutzmechanismen wie Datensparsamkeit, dezentrale Speicherung oder „Privacy by Design“ betonten. Die Speicherung und Verarbeitung der Daten wäre zum grossen Teil von den privaten Anbietern geregelt worden, was die Befürchtung schürte, dass kommerzielle Interessen den Schutz personenbezogener Daten kompromittieren könnten.
- 2024: Die neue Vorlage legt erheblichen Wert auf Datenschutz und inkludiert Grundsätze wie „Privacy by Design“, Datensparsamkeit und eine dezentrale Speicherung. Das bedeutet, dass personenbezogene Daten möglichst minimal verarbeitet und vorzugsweise direkt auf den Endgeräten der Nutzer gespeichert werden, anstatt zentralisiert auf einem Server.
Erweiterte Bewertung: Diese Neuerung spiegelt moderne Datenschutzstandards wider und entspricht den Erwartungen einer datensensiblen Gesellschaft. Die dezentrale Speicherung ist technisch anspruchsvoll, jedoch ein entscheidender Schritt, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. Kritisch bleibt, ob diese Ansätze in der Praxis konsequent umgesetzt werden können und ob der Staat tatsächlich in der Lage ist, Sicherheitsvorfälle und Datenmissbrauch zu verhindern.
3. Technologie und Infrastruktur
- 2020: Es fehlte eine klare Regelung darüber, wer die technische Infrastruktur kontrolliert und wie die Sicherheit der Systeme gewährleistet wird. Der Fokus lag auf der Bereitstellung durch private Anbieter, was zu einer Fragmentierung der Systeme hätte führen können.
- 2024: Der Bund übernimmt die Kontrolle über die gesamte Infrastruktur und gewährleistet, dass diese interoperabel ist und den internationalen Standards wie der eIDAS-Verordnung der EU entspricht. Dies soll sowohl die Sicherheit als auch die Akzeptanz fördern.
Erweiterte Bewertung: Die staatliche Kontrolle der Infrastruktur ist ein wichtiger Schritt, um Sicherheitsstandards zu etablieren und eine einheitliche Nutzung zu ermöglichen. Die Orientierung an internationalen Standards erleichtert zudem die grenzüberschreitende Nutzung. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Schweiz dadurch in Abhängigkeit von EU-Vorgaben gerät und ihre digitale Souveränität einschränkt.
4. Kosten
- 2020: Es gab keine ausdrückliche Regelung zur Kostenfreiheit für Endnutzer. Viele befürchteten, dass die privaten Anbieter die E-ID kostenpflichtig machen könnten.
- 2024: Die neue Vorlage garantiert, dass die Ausstellung der E-ID für Privatpersonen kostenlos ist, was die Akzeptanz steigern soll. Zusätzlich wird die Finanzierung der Infrastruktur durch staatliche Mittel sichergestellt.
Erweiterte Bewertung: Die Kostenfreiheit für die Nutzer ist ein positiver Aspekt, doch die langfristige Finanzierung der Infrastruktur bleibt unklar. Kritiker könnten argumentieren, dass die Allgemeinheit über Steuern für ein System zahlt, das nur von einem Teil der Bevölkerung genutzt wird.
5. Freiwilligkeit und Nutzung
- 2020: Die Nutzung war offiziell freiwillig, jedoch wurden keine klaren Grenzen definiert, ob bestimmte Dienste die E-ID verpflichtend voraussetzen könnten.
- 2024: Auch in der neuen Vorlage bleibt die Nutzung freiwillig. Es wird jedoch eingeräumt, dass einige digitale Behördenleistungen ohne E-ID nur schwer zugänglich sein könnten.
Erweiterte Bewertung: Die „Freiwilligkeit“ ist eine schöne Absicht, doch in der Praxis könnte der Druck steigen, die E-ID zu nutzen, um Zugang zu wichtigen Dienstleistungen zu erhalten. Hier fehlt eine klare Regelung, die sicherstellt, dass auch ohne E-ID keine Bürger benachteiligt werden.
Wichtige Kritikpunkte an der neuen Vorlage
1. Komplexität der Umsetzung
Die Implementierung einer dezentralen Datenspeicherung und einer staatlich kontrollierten Infrastruktur ist technologisch anspruchsvoll und kostspielig. Während die Theorie vielversprechend klingt, bleibt fraglich, ob die Schweiz die notwendige technische Expertise und Ressourcen besitzt, um dieses System erfolgreich und sicher umzusetzen. Cyberangriffe und Datenlecks könnten das Vertrauen der Bürger nachhaltig schädigen.
2. Abhängigkeit von internationalen Standards
Die Anlehnung an die eIDAS-Verordnung der EU erleichtert zwar die Interoperabilität, könnte jedoch dazu führen, dass die Schweiz langfristig Souveränität in digitalen Angelegenheiten verliert. Kritiker sehen hierin eine schleichende Integration in EU-Regularien, die nicht immer den Interessen der Schweiz entsprechen.
3. Vertrauensprobleme bleiben bestehen
Trotz der staatlichen Kontrolle gibt es weiterhin Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit. Viele Bürger haben ein tiefes Misstrauen gegenüber der Speicherung sensibler Daten, selbst wenn diese vom Staat verwaltet werden. Die Angst vor Missbrauch, Überwachung oder Datenlecks bleibt bestehen.
4. Unklare Rechtsfolgen bei Missbrauch
Es fehlen detaillierte Regelungen darüber, wie im Falle eines Missbrauchs oder bei Widerruf der E-ID verfahren wird. Welche Rechte haben Betroffene, und wie können sie sich wehren? Diese Fragen müssen geklärt werden, um das Vertrauen in das System zu stärken.
5. Gefahr der schleichenden Verpflichtung
Auch wenn die Nutzung offiziell freiwillig bleibt, könnten bestimmte Dienstleistungen in Zukunft ausschliesslich über die E-ID zugänglich sein. Dies würde den Druck auf die Bürger erhöhen, die E-ID zu nutzen, selbst wenn sie diese nicht wollen.
Fortschritt oder fauler Kompromiss?
Das neue E-ID-Gesetz 2024 ist ein klarer Fortschritt gegenüber der Version von 2020. Es adressiert viele der damaligen Kritikpunkte, insbesondere durch die staatliche Kontrolle und die Betonung von Datenschutz. Dennoch gibt es wesentliche Schwachstellen:
- Die Abhängigkeit von internationalen Standards birgt Risiken für die Souveränität.
- Die Komplexität der Umsetzung und Sicherheitsrisiken könnten das Projekt in der Praxis scheitern lassen.
- Es bleibt unklar, ob die Freiwilligkeit der Nutzung langfristig bestehen bleibt oder durch indirekte Verpflichtungen ausgehöhlt wird.
Für das bevorstehende Referendum bleibt es vermutlich entscheidend, ob die Bevölkerung Vertrauen in die staatliche Fähigkeit hat, ein solches System sicher und datenschutzkonform umzusetzen. Aber das ist im Grunde nur ein Nebenschauplatz. Es geht um viel mehr: Die Einführung einer digitalen ID führt direkt in einen digitalen Gulag.
Warum jeder klar denkende Schweizer das neue E-ID-Gesetz zwingend ablehnen muss
Schweizerinnen und Schweizer, aufgepasst!
Was uns hier unter dem Deckmantel der Modernisierung und Bequemlichkeit verkauft wird, ist nichts anderes als der erste Schritt in eine digitale Dystopie, die uns Stück für Stück unserer Freiheit berauben wird. Die E-ID, die als staatlich sichere Identitätslösung angepriesen wird, ist in Wahrheit der Türöffner für ein System, das nicht nur unsere Privatsphäre pulverisiert, sondern auch unseren Handlungsspielraum als freie Bürger drastisch einschränkt.
Doch was steckt hinter diesem vermeintlichen Fortschritt? Lassen wir die schöne Verpackung beiseite und schauen auf den hässlichen Kern: die UNO, das WEF und die Agenda 2030.
Der Wolf im Schafspelz: SDG 16.9 und die digitale ID
Hinter dem unscheinbaren Sustainable Development Goal (SDG – Nachhaltigkeitsziel) 16.9 der Agenda 2030, das sich angeblich für „Recht und Frieden“ einsetzt, lauert die Realität: eine global vernetzte Überwachungsinfrastruktur. Die UNO, angeführt von ihren „globalen Partnern“ wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF), verkauft uns die digitale ID als Mittel zur „Inklusion“ und „Gerechtigkeit“. Was in Wahrheit damit gemeint ist? Eine lückenlose Erfassung jedes Bürgers. Eure Identität wird digitalisiert, eure Daten zentral gespeichert, und euer ganzes Leben wird zur Ware, die von Konzernen und Regierungen nach Belieben ausgewertet wird. Es geht hier nicht um Inklusion oder Fortschritt, sondern um totale Kontrolle.
Ohne die digitale ID wird es in Zukunft kaum mehr möglich sein, grundlegende Dinge zu tun: Zugang zu Dienstleistungen, Reisen, Arbeiten oder gar Einkaufen – alles wird von dieser ID abhängen. Die UNO spricht von einem „Menschenrecht auf digitale Identität“, aber wer hat gesagt, dass wir als Bürger überhaupt so tief in digitale Systeme eingebunden werden wollen? Freiheit bedeutet auch die Wahl zu haben, nicht Teil dieses Systems zu sein. Hat uns je jemand dazu befragt?
Die Rolle der Agenda 2030: Ein globaler Überwachungsplan
Die Agenda 2030, die offiziell mit edlen Zielen wie der Bekämpfung von Armut und der Rettung der Umwelt wirbt, ist in Wahrheit ein Manifest zur Umgestaltung unserer Gesellschaft nach technokratischen Prinzipien. Zentraler Bestandteil? Die vollständige Digitalisierung aller Lebensbereiche. Durch die Implementierung von SDG 16.9 wird die digitale ID zu einem Pflichtinstrument für die „Nachhaltigkeit“. Klingt nach Fortschritt? Denkt nochmal nach.
„Nachhaltigkeit“ bedeutet in diesem Kontext nicht etwa Umweltschutz, sondern die nachhaltige Sicherung der Machtstrukturen einer globalen Elite. Das System wird uns mit hübschen Schlagwörtern wie „Netto-Null“, „digitale Inklusion“ und „Datensicherheit“ schmackhaft gemacht. Aber die Wahrheit ist: Eure Freiheit wird nachhaltig abgeschafft. Wer sich diesem System widersetzt, wird ganz einfach ausgeschlossen. Keine ID, kein Zugang. Kein Zugang, kein Leben, wie ihr es kennt.
Von der ID zur digitalen Währung: Der Weg in die Matrix
Eine digitale ID ist nicht nur eine schicke neue Version des Reisepasses. Sie ist der Schlüssel zu einem umfassenden Kontrollnetzwerk. Über diese ID wird euer digitales Leben gesteuert: Bankgeschäfte, medizinische Daten, Reisen, alles wird damit verknüpft. Und jetzt kommt der wahre Clou: Ohne digitale ID gibt es keine Central Bank Digital Currency (CBDC). Diese staatlich kontrollierten digitalen Währungen, die momentan von fast allen Zentralbanken entwickelt werden, sind der letzte Baustein eines perfekten Kontrollsystems.
Mit CBDCs wird Geld „programmierbar“. Es kann genau festgelegt werden, wofür ihr es ausgeben dürft und wofür nicht. Willst du vielleicht ein Steak kaufen, obwohl dein CO₂-Limit ausgeschöpft ist? Pech gehabt, dein Konto wird abgelehnt. Möchtest du dein Geld abheben und unter der Matratze aufbewahren? Unmöglich, denn Bargeld wird abgeschafft. Und das alles geschieht „für den Klimaschutz“. Klingt das nach einer freien Gesellschaft, in der ihr selbstbestimmt handeln könnt?
Die schleichende Einführung: Wie uns das Gesetz verkauft wird
Ihr fragt euch vielleicht: Aber warum so viel Aufregung? Das neue Gesetz klingt doch harmlos! Genau hier liegt der Trick. Es wird euch als freiwillige Möglichkeit präsentiert, aber wie lange bleibt es freiwillig? Schon jetzt gibt es zahlreiche Beispiele weltweit, wie aus „freiwillig“ ganz schnell „verpflichtend“ wird. In Kuwait wurden Bürger, die sich nicht biometrisch erfassen liessen, von ihren Bankkonten abgeschnitten. In Indien kann niemand mehr staatliche Leistungen erhalten, ohne in das digitale ID-System eingebunden zu sein. Und in der Schweiz? Ihr werdet sehen, wie Behördengänge, medizinische Dienstleistungen und mehr bald nur noch über die E-ID möglich sein werden. Der Druck wird wachsen, bis euch keine Wahl mehr bleibt.
Die dunkle Wahrheit hinter dem System
Die UNO und ihre Partner im WEF und der Weltbank sind nicht an eurem Wohl interessiert. Es geht hier um die Zentralisierung von Macht und die Kontrolle über jeden Einzelnen. Warum sonst würden sie so viel Energie und Geld in den Aufbau eines global interoperablen Systems stecken? Von der Geburt bis zum Tod soll jede Aktion, jede Entscheidung und jede Transaktion eines Menschen erfasst und ausgewertet werden. Ihr seid keine Bürger mehr, sondern Datensätze in einer globalen Datenbank.
Das Ziel ist klar: Eine Welt, in der ihr „nichts besitzt und glücklich seid“. Eine Welt, in der euch gesagt wird, wie ihr zu leben habt, und in der jedes Abweichen vom vorgegebenen Kurs Konsequenzen hat. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist der offene Plan der Technokraten, die uns eine „nachhaltige“ Zukunft versprechen.
Euer Widerstand zählt: Sagt Nein zum digitalen Gulag
Noch können wir etwas tun. Noch können wir Nein sagen. Die Schweiz hat 2021 bereits gezeigt, dass sie sich nicht so leicht von den globalen Eliten manipulieren lässt. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Das neue E-ID-Gesetz ist ein weiterer Versuch, uns in ein System zu drängen, das nichts mit Schweizer Werten von Freiheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu tun hat.
Unterschreibt das Referendum. Informiert eure Freunde und Familie. Und wenn es zur Abstimmung kommt, stimmt mit einem klaren Nein. Lasst uns gemeinsam verhindern, dass die Schweiz zum Vorbild eines globalen digitalen Gefängnisses wird. Eure Freiheit hängt davon ab.
Und denkt daran: Freiheit braucht keine digitale ID. Die Schweiz auch nicht. Aber der Bundesrat? Nun ja, er will wohl vermeiden, von seinen globalen Partnern eine Rüge dafür zu kassieren, nicht brav die Agenda umzusetzen. Er steht unter Druck, denn das Jahr 2030 rückt näher. Lassen wir ihn zappeln!
Illusion 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen
➡️ Zur Formulierung des 12. Zieles der UNO Agenda 2030 & EDA (Täuschung)
⚠️ Das «social credit system» soll nach dem Vorbild Chinas umgesetzt werden. Dies wird mittels einer digitalen ID, in welcher alle Bereiche abgebildet sein werden, vorgenommen. Das verfügbare digitale Geld hat ein Ablaufdatum, um so den Konsum am Laufen zu erhalten. Es wird eine weltweite digitale Währung geben.
Es wird CO2-Budgets geben, welche sich am Sozialkredit-Punktesystems des chinesischen Modells orientieren, bei denen jeder Mensch individuell für seinen Konsum oder sein Verhalten bestraft oder belohnt werden kann.

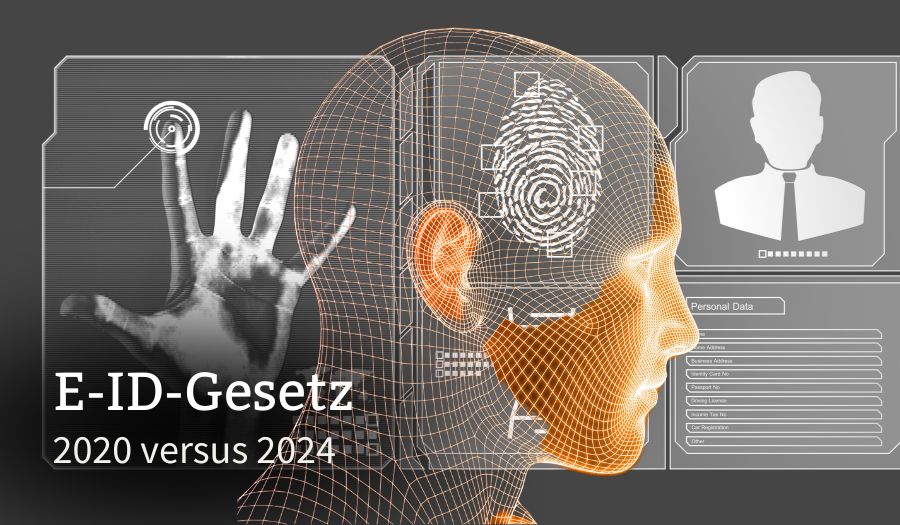






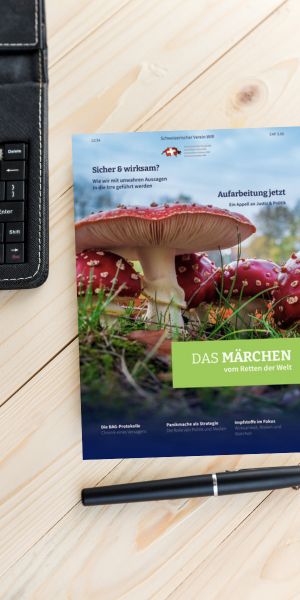
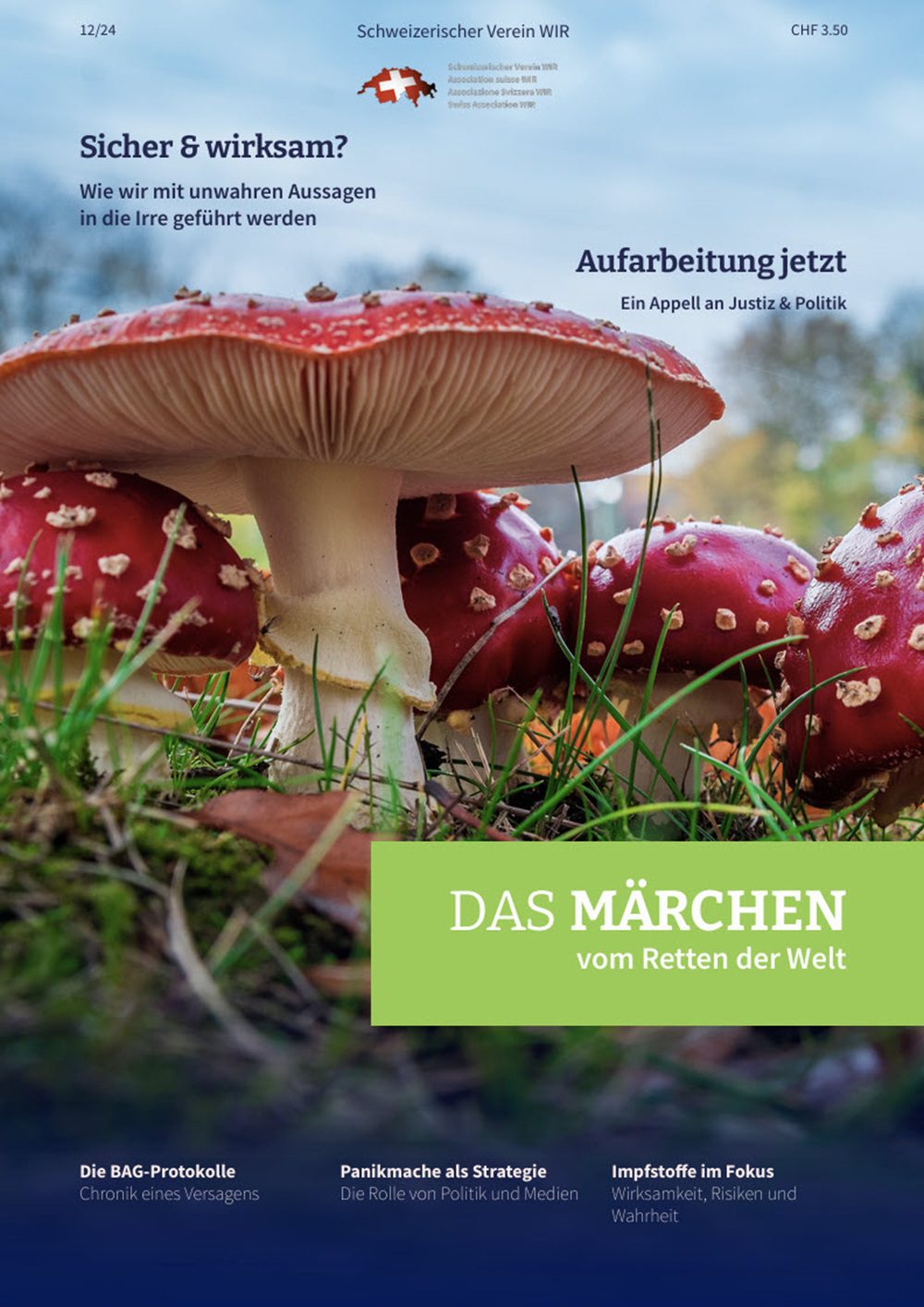
0 Comments